
Die Lebensverhältnisse in städtischen und ländlichen Regionen können sehr unterschiedlich sein – auch im Bereich Armut. Dieser Artikel stellt die Armutssituation im ländlichen Raum und den Stadtregionen Nordrhein-Westfalens gegenüber.1 Zur Darstellung der Unterschiede zwischen Stadt und Land werden dabei die Indikatoren Armutsgefährdungsquote, materielle und soziale Entbehrung und die Mindestsicherungsquote herangezogen. Erstellt wurde dieser Artikel in Kooperation mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS). Er basiert auf den Ergebnissen der Kurzanalyse Lebensverhältnisse und Armut im ländlichen Raum, die IT.NRW im Rahmen der jährlichen Kurzanalysen zur Sozialberichterstattung im Auftrag des MAGS erstellt hat.
Ein Kooperationsprojekt von IT.NRW und dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahr 2025
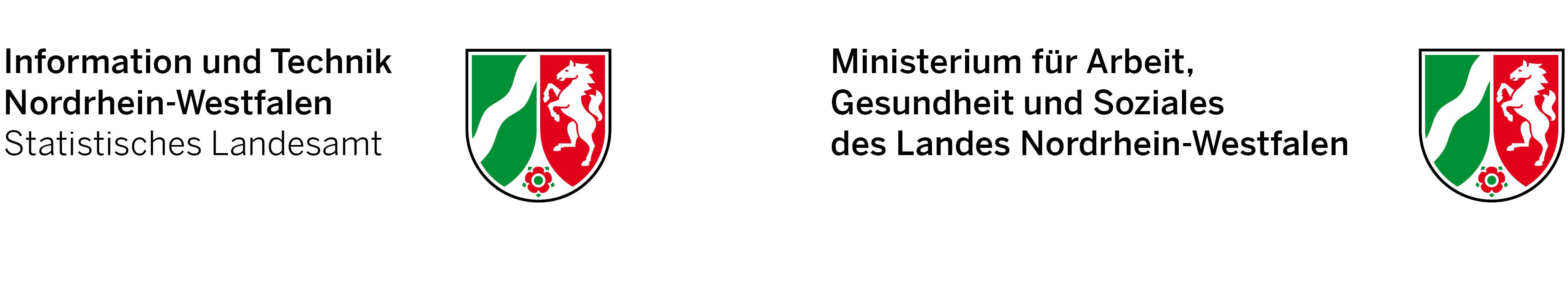
Armutsgefährdungsquote
Wo ist die Armutsgefährdung höher – im ländlichen oder städtischen Raum?
Ob eine Person als armutsgefährdet gilt, lässt sich aus dem Haushaltseinkommen ableiten. Einen gängigen Indikator stellt die sogenannte Armutsgefährdungsquote dar. Sie gibt den Anteil der Personen an, denen weniger als 60 % des mittleren bedarfsgewichteten Haushaltseinkommens der Bevölkerung zur Verfügung steht. Wie sich die Armutsgefährdungsquoten zwischen Stadt und Land in NRW unterscheiden, ist in der folgenden Grafik dargestellt. Zusätzlich wurde dabei nach weiteren Merkmalen (Altersgruppen, Lebensformen u. a.) unterschieden, um der unterschiedlichen soziodemografischen Struktur zwischen Stadt und Land Rechnung zu tragen.
Armutsgefährdungsquote in NRW 2024 nach Raumtyp und ausgewählten soziodemografischen Merkmalen
Materielle und soziale Entbehrung
Ländlicher Raum etwas weniger von erheblicher materieller und sozialer Entbehrung betroffen
Armut zeigt sich auch, indem Menschen aufgrund der finanziellen Lage von materieller und sozialer Entbehrung (auch: Deprivation) betroffen sind und somit unfreiwillig auf bestimmte Güter, Dienstleistungen oder soziale Aktivitäten verzichten müssen. Bezogen auf die Unterschiede zwischen ländlichem Raum und Stadtregionen zeigt sich für NRW, dass 2024 mit 7 % im ländlichen Raum anteilig etwas weniger Menschen angaben, von einer erheblichen materiellen und sozialen Entbehrung betroffen zu sein als in städtischen Regionen (rund 8 %). Die Angaben beruhen dabei auf Basis freiwilliger Selbsteinschätzungen. In den drei Bereichen mit den höchsten Quoten zur materiellen und sozialen Entbehrung lagen kaum Unterschiede zwischen den Raumtypen vor. Die Quoten waren jedoch im ländlichen Raum minimal höher als in den Stadtregionen. Für alle weiteren Güter und Dienstleistungen gaben hingegen anteilig mehr Menschen in den Stadtregionen an, sich diese nicht leisten zu können als in den ländlichen Regionen. Die größten Unterschiede zwischen den beiden Raumtypen waren für die Bereiche „ein Auto zu besitzen“ und „jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit zu essen“ vorzufinden.
Kriterien zur sozialen und materiellen Entbehrung in NRW 2024
Menschen konnten es sich aus finanziellen Gründen nicht leisten…
Mindestsicherungsquote
Unterschiede auch innerhalb der Raumtypen zu erkennen
Nicht nur zwischen städtischem und ländlichem Raum in NRW zeigen sich Unterschiede in Bezug auf Armut, auch auf der Gemeindeebene innerhalb der beiden Raumtypen sind regionale Unterschiede zu beobachten. Die Armutsgefährdungsquoten sind jedoch nicht auf Gemeindeebene auswertbar. Daher wird die sogenannte Mindestsicherungsquote aus dem Jahr 2023 herangezogen,2 um die regionalen Unterschiede im Bereich Armut auch auf Gemeindeebene darzustellen.
Mindestsicherungsleistungen sind Geldleistungen für Menschen, deren Einkommen nicht zur Sicherung des Lebensunterhalts ausreicht (z. B. Bürgergeld, Grundsicherung im Alter oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz). Der Anteil der Personen mit Bezug von Mindestsicherungsleistungen an der Gesamtbevölkerung wird als Mindestsicherungsquote bezeichnet.
Im Jahr 2023 fiel die Mindestsicherungsquote im ländlichen Raum Nordrhein-Westfalens mit rund 8 % rund 4 Prozentpunkte niedriger aus als in den Stadtregionen (12 %). Auf Ebene der Gemeinden wurden die niedrigsten Mindestsicherungsquoten mit etwa 3,5 % in der städtischen Region Roetgen und in der ländlichen Gemeinde Südlohn gemessen. Damit unterschieden sich die niedrigsten Mindestsicherungsquoten kaum zwischen den Raumtypen. Bei den höchsten Mindestsicherungsquoten nach Raumtyp waren dagegen deutlichere Unterschiede zu erkennen. So war die höchste Mindestsicherungsquote in der zur ländlichen Region zählenden Stadt Minden mit rund 15 % vorzufinden. Diese Quote lag damit aber deutlich niedriger als in der Stadt Gelsenkirchen mit 22 % – der höchsten Mindestsicherungsquote im städtischen Raum in NRW. Insgesamt ist zudem festzustellen, dass sich die höchsten Mindestsicherungsquoten in den Ruhrgebietsstädten zeigten.
Mindestsicherungsquoten der Gemeinden in NRW zum Jahresende 2023
Zentrale Ergebnisse
Zusammenfassung
In Nordrhein-Westfalen waren im Jahr 2024 die Menschen in den städtischen Regionen häufiger armutsgefährdet als im ländlichen Raum. Insbesondere für jüngere Menschen, Haushalte mit mindestens einem minderjährigen Kind sowie Erwerbslose war die Armutsgefährdung in Stadtregionen höher als im ländlichen Raum. Lediglich Menschen ab 65 Jahren und Paare ohne Kind waren auf dem Land häufiger armutsgefährdet als in Stadtregionen. Bei den Indikatoren zur materiellen Deprivation war ein ähnlicher Trend zu beobachten. So gaben anteilig etwas mehr Menschen im städtischen Raum an, von einer erheblichen materiellen und sozialen Entbehrung betroffen zu sein als in ländlichen Regionen. Dabei konnten es sich die Menschen am häufigsten aus finanziellen Gründen nicht leisten, unerwartete Ausgaben aus eigenen Mitteln zu bestreiten, jedes Jahr einen einwöchigen Urlaub zu machen oder abgewohnte Möbel zu ersetzen. In diesen Bereichen waren die Quoten zur Deprivation wiederum im ländlichen Raum minimal höher als in den Stadtregionen. Schließlich zeigte sich beim Bezug von Mindestsicherungsleistungen im Jahr 2023 im Vergleich zum ländlichen Raum in städtischen Regionen und insbesondere im Ruhrgebiet ein höherer Anteil an Personen, die Mindestsicherungsleistungen bezogen.
Fußnoten
1 Basierend auf der Raumtypologie RegioStaR2 (weitere Informationen befinden sich in den methodischen Hinweisen).
2 Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lagen Zahlen für 2024 noch nicht vor.
Methodische Hinweise und Datengrundlage
Raumtypologie RegioStaR2
Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV 2021) hat im Jahr 2021 die neue Regionalstatistische Raumtypologie (RegioStaR) konzipiert und mit Unterstützung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) umgesetzt. In dieser Kurzanalyse wird die erste Abgrenzungsform, die RegioStaR2, verwendet, welche die Regionen in Stadtregionen und ländliche Regionen aufteilt. In der RegioStaR2 Typologie werden methodisch zunächst Großstädte und deren Verflechtungsbereiche bestimmt und als städtische Region festgelegt. In einem weiteren Schritt werden die Einzugsbereiche der Großstädte definiert und im Falle von übergemeindlichen Pendlerverflechtungen zu einem zusammenhängenden Gebiet zusammengefasst. Alle Städte und Gemeinden außerhalb der so definierten Verflechtungsbereiche der Großstädte werden als ländliche Regionen eingestuft. Sie sind also auf der großräumigen Betrachtungsebene eine komplementäre „Restkategorie“ zu den Stadtregionen.
Definition der Armutsindikatoren
Die Armutsgefährdungsquote gibt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Personen mit einem Einkommen unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle an der nordrhein-westfälischen Bevölkerung ist. Entsprechend der EU-Konvention wird von einer Armutsgefährdungsschwelle von 60 % des Medians der Nettoäquivalenzeinkommen ausgegangen. In Nordrhein-Westfalen betrug der Median der Nettoäquivalenzeinkommen im Jahr 2024 für einen Einpersonenhaushalt 2.150 Euro. Die Armutsgefährdungsschwelle lag damit bei 1.290 Euro.
Die Mindestsicherungsquote stellt den Anteil der Empfängerinnen und Empfänger von Mindestsicherungsleistungen an der Gesamtbevölkerung (bzw. der jeweiligen Bevölkerungsgruppe) dar. Dazu zählen die Gesamtregelleistung (ALG II/Sozialgeld) nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II „Grundsicherung für Arbeitsuchende“), die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII „Sozialhilfe“), die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII „Sozialhilfe“) sowie die Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).
Erhebliche materielle und soziale Entbehrung liegt nach der EU-Definition für EU-SILC dann vor, wenn aufgrund der Selbsteinschätzung des Haushalts mindestens sieben der folgenden 13 Kriterien erfüllt sind. Der Haushalt bzw. das Individuum kann sich finanziell nicht leisten:
1. Hypotheken, Miete, Rechnungen von Versorgungsbetrieben oder Konsum-/ Verbraucherkredite rechtzeitig zu bezahlen
2. die Unterkunft angemessen warm zu halten
3. jedes Jahr einen einwöchigen Urlaub an einem anderen Ort zu verbringen
4. jeden zweiten Tag eine Mahlzeit mit Fleisch, Fisch oder gleichwertiger Proteinzufuhr zu essen
5. unerwartet anfallende Ausgaben aus eigenen Mitteln zu bestreiten (2024: 1.250 Euro)
6. ein Auto zu besitzen (kein Firmen-/Dienstwagen)
7. abgewohnte Möbel zu ersetzen
8. abgetragene Kleidungsstücke durch neue (nicht Second-Hand-Kleidung) zu ersetzen
9. mindestens zwei Paar passende Schuhe in gutem Zustand zu besitzen
10. wöchentlich einen geringen Geldbetrag für sich selbst aufzuwenden
11. regelmäßige Freizeitaktivitäten (auch wenn diese Geld kosten)
12. mindestens einmal im Monat mit Freunden/Familie für ein Getränk/eine Mahlzeit zusammenzukommen
13. eine Internetverbindung zu haben
Datengrundlage
Die hier dargestellten Daten stammen aus dem Mikrozensus, der Sozialhilfestatistik, der Statistik der Grundsicherung im Alter, der Asylbewerberleistungsstatistik, der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus 2022 sowie der Bundesagentur für Arbeit, Ergebnisse der Statistik der Grundsicherung für Arbeitsuchende jeweils zum Berichtsmonat Dezember (Datenstand: März 2024).
Weiterführendes
Weitere spannende Daten und Ergebnisse zum Thema Armut sowie methodische Informationen können Sie auf der Themenseite Armut sowie in der Landesdatenbank finden.
Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns an.
Zur Kontaktseite
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Der zentrale statistische Auskunftsdienst ist Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um Statistik und das Statistische Landesamt.